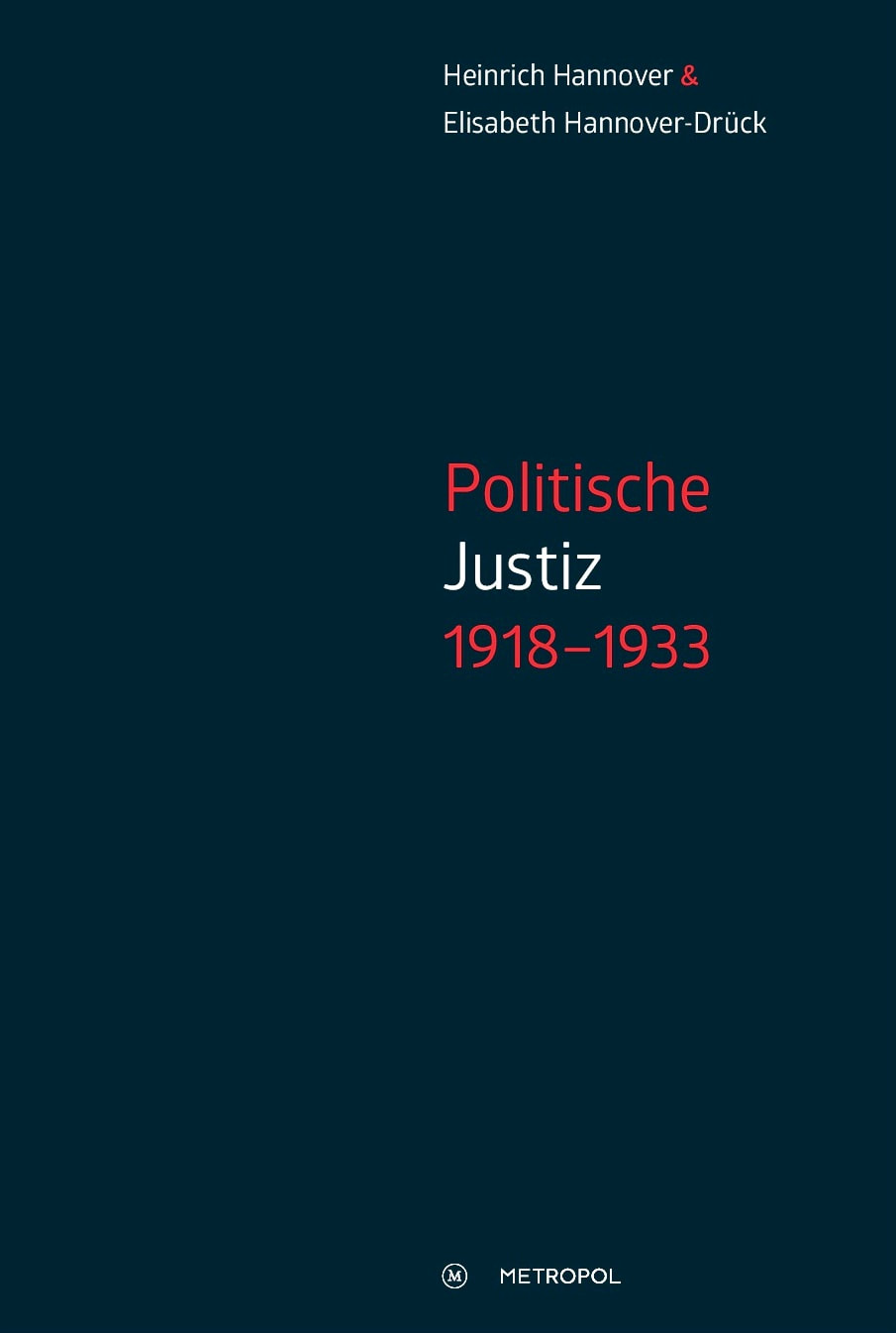|
Das Buch „Politische Justiz 1918-1933“ ist die Neuauflage eines juristischen Klassikers von Heinrich Hannover und seiner 2009 verstorbenen Ehefrau Elisabeth Hannover-Drück. Er als politisch engagierter Strafverteidiger und sie als Historikerin, schreiben über politische Prozesse in der Weimarer Republik. Das ist nicht nur Strafrechtsgeschichte, sondern auch Zeitgeschichte und für Juristen eigentlich ein Muss.
Das Buch wurde bereits 1966 im S. Fischer Verlag veröffentlicht. Hannover schreibt dazu in seinem Vorwort: „Ich war als Strafverteidiger in politischen Strafprozessen gegen Kommunisten und anderen Gegnern der Adenauer – Politik darauf aufmerksam geworden, dass sich in diesen Verfahren der 1950er- und 1960er-Jahre deutsche Geschichte wiederholt.“ Die juristische Legende Fritz Bauer hielt 1967 in einem Artikel in der „Zeit“ fest: „Zu den beliebtesten Lebenslügen unserer deutschen Umwelt gehört die Annahme, der nazistische Unrechtsstaat habe anno 1933 begonnen. Das Autorenteam Hannover weiß und beweist, daß der Nationalsozialismus nicht über Nacht gekommen ist, übrigens auch nicht über Nacht wieder verschwand.“ Dem ist nichts hinzuzufügen. Bereits lange vor 1933 war die Justiz auf dem rechten Auge blind. Das endete auch nicht 1945, sondern wirkt bis heute fort. Schmähungen der Republik und Beleidigungen von Politikern waren in der Weimarer Republik an der Tagesordnung und wurden von der Justiz nicht hinreichend verfolgt. Die Autoren zeigen Beispiele auf und man fühlt sich dabei an das Hier und Jetzt erinnert. Historisch beginnt das Buch mit Noskes Schießbefehl und gelangt über die Münchner Räterepublik zum Kapp-Putsch. Standgerichte und willkürliche Erschießungen waren an der Tagesordnung. Meist kamen die Täter mehr als glimpflich davon, während den Angehörigen der Opfer mitunter nicht mal eine Rente gewährt wurde, Später folgen dann die politischen Morde, die mit allzu milden Urteilen für die Täter geahndet wurden. Die Autoren beschreiben neben wenig bekannten Taten, auch die Morde an Walther Rathenau und Matthias Erzberger, dessen Mörder auch noch nach dem Zweiten Weltkrieg von der Nachkriegsjustiz freigesprochen wurden. Ein Blausäureattentat auf Philipp Scheidemann, der inzwischen nicht mehr in der Regierung, aber Oberbürgermeister seiner Geburtsstadt Kassel, war, ging glimpflich aus. Massiv verhöhnt wurde das Opfer auch noch nach der Tat, lange vor der Erfindung des World Wide Web. Die Parallelen zu heute sind beklemmend. Die Fememörder Martin Bormann und Rudolf Höß gehörten später zum NS-Adel. Während Journalisten und „Whistleblower“ von der Justiz verurteilt wurden, hatten Mörder eher wenig zu befürchten. Die Vorgeschichte der NS-Zeit macht deutlich, dass die Drangsalierung politisch Andersdenkender und Minderheiten von breiten Schichten des Bürgertums getragenen wurde. Republikfeindschaft und Antisemitismus waren an der Tagesordnung. Nicht dieses Treiben, sondern die Freiheit von Kunst und Kultur wurde von der Justiz eingeschränkt. Der 1925 geborene Heinrich Hannover, stritt einst für kommunistische Widerstandskämpfer der Nazi-Diktatur und verteidigte die Wortführer der Studentenbewegung. Auch und erst recht heute sorgt er sich immer noch um die Demokratie und ihre Justiz. Ernst Reuß Heinrich Hannover / Elisabeth Hannover-Drück, Politische Justiz 1918–1933, Metropol Verlag, Berlin 2019, 368 Seiten, 22 € Comments are closed.
|
AutorErnst Reuß, geboren 1962 in Franken. Studium der Rechtswissenschaften in Erlangen und Wien. Promotion an der Humboldt - Universität zu Berlin. Danach als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Freien Universität Berlin und im Bundestag beschäftigt. Archiv
März 2024
|